Die COPLANT-Studie – Forschung zu pflanzenbasierter Ernährung
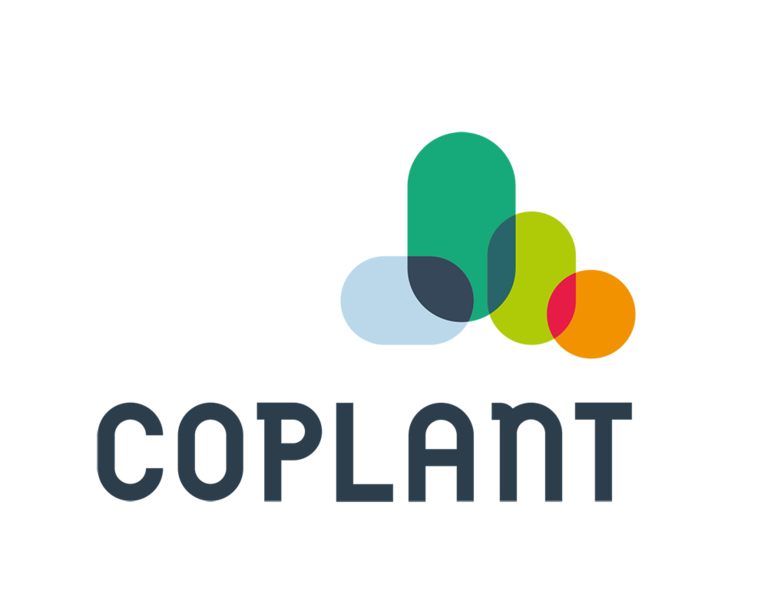
COPLANT steht für COhort on PLANT-based Diets. Dahinter verbirgt sich die bisher größte geplante Kohortenstudie zu pflanzenbasierter Ernährung im deutschsprachigen Raum. Ab 2024 möchte das Max Rubner-Institut (MRI) gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin, dem Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung (IFPE) Gießen, fünf universitären Partnern – Friedrich-Schiller-Universität Jena, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Universität Regensburg, Universität Wien – sowie in Kooperation mit dem Johann Heinrich von Thünen-Institut deutschlandweit ca. 6.000 Personen im Alter von 18–69 Jahren untersuchen und befragen. Der Begriff „pflanzenbasierte Ernährung“ wurde in den letzten Jahren neu geprägt und umfasst Ernährungsweisen, deren Hauptbestandteile rein pflanzlichen Ursprungs sind – darunter Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Öle, (Vollkorn-) Getreide und Hülsenfrüchte sowie deren rein pflanzlichen Verarbeitungsprodukte. Je nach Ernährungsweise kommen Milchprodukte, Fisch, Meeresfrüchte und Eier hinzu. Gegenstand der COPLANT Studie bilden die folgenden Ernährungsweisen:
- vegan (keine tierischen Produkte)
- vegetarisch (kein Fleisch und Fisch, aber Milchprodukte und/oder Eier)
- pescetarisch (kein Fleisch, aber Fisch, Milchprodukte und Eier)
- omnivor: sowohl pflanzliche als auch alle tierischen Produkte (Mischkost)
Ziele der COPLANT-Studie
Ziel der Studie ist es, neue Erkenntnisse zu den Vor- und Nachteilen pflanzenbasierter Ernährungsweisen im Vergleich zu einer Mischkost zu gewinnen. Es wird beispielsweise untersucht, welche Vitamine und Mineralstoffe ausreichend aufgenommen werden und welche zu kurz kommen. Was passiert im Stoffwechsel, wenn komplett auf tierische Lebensmittel verzichtet wird? Wie wirken sich die einzelnen Ernährungsweisen auf die Körperzusammensetzung und die Knochengesundheit aus? Haben die Ernährungsweisen einen Einfluss auf die Zusammensetzung und Aktivität der Darmflora? Gibt es Unterschiede im Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln (hvLM) (ultra processed foods) zwischen den Ernährungsweisen und wird ein metabolisches Risiko (gesund/ungesund) abgebildet? Außerdem möchten wir bei der Studie herausfinden, mit welchen ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen die jeweiligen Ernährungsweisen verbunden und wie nachhaltig diese insgesamt sind.
Es sollen Zusammenhänge zwischen pflanzenbasierten Ernährungsweisen und dem Gesundheitszustand sowie verschiedenen gesellschaftsrelevanten Auswirkungen tiefergehend untersucht werden. Daraus sollen Empfehlungen für eine gesundheitsfördernde und zugleich nachhaltige Ernährung abgeleitet werden.
Datenlücken schließen
Obwohl das Interesse für vegane und vegetarische Ernährungsweisen stetig wächst, liegen derzeit nur wenige wissenschaftlich fundierte Daten zur pflanzenbasierten Kost vor. Ältere Studien zum Thema sind kaum mit den heutigen Ernährungsweisen vergleichbar. Beispielsweise steigt das Angebot von veganen Lebensmitteln und Fleischersatzprodukten, die teilweise hochverarbeitet, zucker-, fett- und salzreich sind. Aktuell gibt es keine größeren epidemiologischen Projekte in Deutschland, die gezielt Veganerinnen und Veganer untersuchen und angepasste Ernährungserhebungsinstrumente für diese Ernährungsweise benutzen. Im Gegensatz dazu ist die Datenlage zu den gesundheitlichen Wirkungen einer vegetarischen Ernährungsweise recht gut. Pflanzenbasierte Ernährungsweisen gehen im Allgemeinen mit einem geringeren Risiko für Lebensstilassoziierte Erkrankungen einher. Ob dies für eine vegane Ernährungsweise auch zutrifft, ist bisher nur unzureichend untersucht. Erkenntnisse über Nachhaltigkeitswirkungen verschiedener Ernährungsweisen liegen bislang nur in einzelnen Facetten, jedoch nicht in der Gesamtschau aller relevanten Dimensionen Gesundheit, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft vor. COPLANT soll dies ändern, bestehende Datenlücken schließen und somit evidenzbasierte Ernährungsempfehlungen zu einer pflanzenbasierten und nachhaltigen Ernährung ermöglichen.
Prävention von Volkskrankheiten
Um Zusammenhänge zwischen Ernährungsweise und typischen Volkskrankheiten wie z. B. Typ 2 Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs beurteilen zu können, wird eine Nachbeobachtung der Studienteilnehmenden von mindestens 20 Jahren angestrebt. Die erhobenen Daten könnten wertvolle Einblicke für neue Präventions- und Therapiekonzepte liefern.
Besonderheiten zur Datenerhebung
Ernährungserhebung
Der Lebensmittelverzehr inklusive des Konsums neuartiger veganer und vegetarischer Lebensmittel (Fleisch- und Milchersatzprodukte), wird für mehrere Tage mittels einer speziell für die COPLANT Studie angepassten App erhoben. Die Teilnehmenden werden gebeten, an den vereinbarten Protokolltagen alle verzehrten Lebensmittel und Getränke zu wiegen und in einer App zu protokollieren. Hier können die Teilnehmenden anhand eines sogenannten Wiegeprotokolls sehr genau die Menge der verzehrten Lebensmittel dokumentieren. Verpackte Lebensmittel können über das Scannen der Barcodes auf der Verpackung einfach und direkt in die App eingetragen werden. Neben der genauen Erfassung der verzehrten Menge werden für die Lebensmittel weitere Informationen wie Verpackung und Zustand beim Einkauf, die Zubereitung oder die Art der Erzeugung (biologisch oder konventionell) erfragt.
Um Informationen zu den üblichen Ernährungsgewohnheiten zu erhalten, wird zusätzlich von jedem Teilnehmenden ein Verzehrhäufigkeitsfragebogen (FFQ) ausgefüllt, welcher die Ernährung über das letzte Jahr abfragt.
Hochverarbeitete Lebensmittel
Das Angebot und der Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln haben in den letzten Jahren zugenommen. Als hochverarbeitet gelten Lebensmittel deren Grundzutaten viele Verarbeitungsschritte durchlaufen haben, die häufig einen oder mehrere Zusatzstoffe enthalten und die meist industriell hergestellt sind. Verzehrsmuster, die durch hochverarbeitete Lebensmittel geprägt sind, stehen im Zusammenhang mit dem Auftreten von ernährungsmitbedingten Erkrankungen. Neue Produkte, die tierische Lebensmittel ersetzen sollen, wie Pflanzendrinks oder Fleischersatzprodukte, sind nahezu ausschließlich hochverarbeitet. In COPLANT soll untersucht werden, ob sich der Verzehr und die ernährungsphysiologische Qualität von hochverarbeiteten Lebensmitteln zwischen den Ernährungsweisen unterscheidet.
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsaspekte werden in Bezug auf Einkauf, Lagerung, Zubereitung und Verzehr von Lebensmitteln sowie weitere Themen über einen Fragebogen erhoben. Darüber hinaus werden mit einer Auswahl interessierter Teilnehmenden Interviews geführt. Diese finden vor Ort im Studienzentrum oder in Ausnahmefällen online per Videoanruf statt und behandeln persönliche Perspektiven auf Ernährung.
Weiterführende Informationen zur Nachhaltigkeitsanalyse
Darmflora
Ernährung beeinflusst die Zusammensetzung unserer Darmflora von Tag zu Tag, aber auch langfristig. Unter Darmflora sind die Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Viren) in unserem Verdauungstrakt zu verstehen, die auch als Darmmikrobiom bezeichnet werden. In COPLANT soll untersucht werden inwiefern Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Darmmikrobiom von Personen mit unterschiedlichen Ernährungsweisen erkennbar sind. Dabei wird sowohl die Zusammensetzung als auch die Aktivität (welche Metabolite werden von diesen Mikroorganismen produziert?) des Mikrobioms betrachtet. Hierfür werden in den gesammelten Stuhlproben sowohl Mikroorganismen anhand ihrer DNA identifiziert und quantifiziert als auch deren Stoffwechselprodukte bestimmt. Neben den prokaryotischen Mitgliedern des Mikrobioms (Bakterien und Archaeen) werden auch die weniger gut untersuchten Gruppen der Pilze (das Mykobiom) und Bakteriophagen (das Phageom) untersucht. Da die Verbreitung von multiresistenten Bakterien ein ernstes medizinisches Problem darstellt, sollen außerdem die Verbreitung von Genen für Antibiotikaresistenz (das Resistom) in den verschiedenen Gruppen bestimmt werden. Und schließlich wird auch die menschliche Physiologie vor allem im Darm direkt vom Mikrobiom beeinflusst. Daher soll anhand von Blutparametern die Funktion der Darmbarriere ermittelt werden. Die Kernfragen all dieser Messungen betreffen die unterschiedliche Wirkung der verschiedenen Ernährungsweisen auf das Darmmikrobiom und seine Bedeutung für den Menschen. Wir hoffen, durch Korrelationen zwischen mikrobiellen Parametern, Ernährungsdaten und physiologischen Biomarkern das Ökosystem Darm besser zu verstehen und Empfehlungen für eine nachhaltige pflanzen-basierte Diät zu definieren, die auch die Darmgesundheit unterstützt.
Metabolom
Das Metabolom ist die Gesamtheit aller Stoffwechselprodukte (Metabolite) in einem Organismus zu einer bestimmten Zeit und damit eine Art „Schnappschuss“ des aktuellen Stoffwechselzustands. Die Bioproben aus COPLANT (Blut, Urin und Speichel) sollen mit verschiedenen analytischen Methoden untersucht werden, wie z. B. Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS) oder Kernspinresonanz-Spektroskopie (NMR). Das Ziel hierbei ist, möglichst viele Metaboliten aus vielen verschiedenen Stoffwechselwegen zu erfassen. Dabei kann die Analyse gerichtet („targeted“) erfolgen, d.h. eine bestimmte Stoffklasse oder Gruppe von Metaboliten wird gemessen, oder ungerichtet („untargeted“), d.h. alles, was mit dieser Methode technisch möglich ist, wird erfasst, auch wenn die Substanz (noch) nicht identifiziert ist. Die Zusammensetzung der gemessenen Metabolite und somit deren Muster spiegelt unter anderem die Auswirkungen der verschiedenen Ernährungsweisen auf den Stoffwechsel wider, und erlaubt damit auch Rückschlüsse auf die Gesundheit der Teilnehmenden. (Forschungsbereich Bioverfügbarkeit und Biomarker für den Lebensmittelverzehr)
Modul „Kids/Family“
Am MRI sowie am BfR könne zusätzlich zu den erwachsenen Studienteilnehmenden auch deren Kinder miteinbezogen und untersucht werden, um u. a. Einflüsse des familiären Ernährungsumfelds auf das Ernährungsverhalten der Kinder und Jugendlichen sowie potenzielle soziale und psychologische Verhaltensdeterminanten zu untersuchen. Neben der primären Erhebung mittels Fragebögen werden bei den Kindern und Jugendlichen zusätzlich anthropometrische Parameter erhoben.
Auch Schwangere (und nachfolgend Stillende) werden im Rahmen der Rekrutierung für die COPLANT Studie eine zahlenmäßig kleine Subgruppe (geplant ca. 120 Probandinnen) bilden. Innerhalb der Querschnittsstudie wurden für die zu untersuchenden Probandinnen 3 Untersuchungszeitpunkte festgelegt:
- 3. Trimenon (Drittel) der Schwangerschaft
- 3-4 Monate nach der Geburt und
- 1-2 Jahre nach der Geburt (= originärer COPLANT-Studientermin).
Neben Datenerhebungen aus dem Mutterpass (u.a. Gewicht am Beginn der Schwangerschaft, Gewichtszunahme, Schwangerschaftswoche bei Geburt, Geburtsmodus) und dem Kinderuntersuchungsheft (u.a. Geburtsgewicht, -größe, postnatale Gewichtsentwicklung) werden ein Fragebogen zu Aspekten der kindlichen Entwicklung sowie der Gesundheit, Bewegung und des Lebensumfeldes von Mutter und Kind sowie ein Ernährungsfragebogen eingesetzt. Dieser wird auch spezifische Fragen zum Stillen (u.a. Beginn und Dauer des Voll- bzw. Teilstillens) und zur Beikost des Kindes (Zeitpunkt der Einführung, Zusammensetzung) einschließen. Weiterhin werden anthropometrische Untersuchungen, Blut-, Urin- und Stuhluntersuchungen bei der Mutter und als spezieller Teil die Untersuchung von Muttermilch-Proben im Zeitraum 3-4 Monate nach der Geburt durchgeführt.
Körperliche Aktivität
Ernährung und Bewegung sind wesentliche Faktoren für Gesundheit und Wohlbefinden. Wer sich gesund ernährt ist oftmals auch aktiver. Um Zusammenhänge zwischen Ernährung, Bewegung und Gesundheit besser beurteilen zu können, befragen und untersuchen wir die Teilnehmenden zu ihrem Bewegungsverhalten mit einem standardisierten Fragenbogen und mit Bewegungssensoren, sog. Akzelerometern, die über sieben Tage am Körper getragen werden. (Forschungsbereich Ernährung und Bewegung)
Eckdaten zum Studienablauf
Die Basisuntersuchung umfasst neben der ausführlichen Ernährungserhebung per App u. a. die Messung von:
- Körperzusammensetzung
- Knochengesundheit
- Handgreifkraft
- körperlicher Aktivität
Folgende Bioproben werden von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genommen:
- Nüchtern-Blutprobe
- Urinprobe über 24 Stunden gesammelt sowie eine Spontanurinprobe
- Stuhlprobe
- Speichelprobe
Über Befragungen werden Daten zu folgenden Themen erhoben:
- spezifische Aspekte der Ernährungsweise, z. B. Dauer der Ernährungsweise und Motivation
- allgemeine Charakteristika, z. B. Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf
- Gesundheit, darunter allgemeines Wohlbefinden sowie Vorliegen von Erkrankungen (z. B. Allergien)
- Lebensstilfaktoren, z. B. Rauchen und körperliche Aktivität
- Nachhaltigkeit in Bezug auf Ernährungsverhalten und Lebensführung
COPLANT in Zahlen
- 8 Studienzentren (BfR Berlin, Friedrich-Schiller-Universität Jena, IFPE Gießen, MRI Karlsruhe, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Universität Regensburg sowie Universität Wien)
- Deutschlandweit ca. 6.000 Studienteilnehmende im Alter von 18–69 Jahren mit veganer, vegetarischer, pescetarischer oder omnivorer Ernährungsweise (ca. 800 am Studienzentrum Karlsruhe)
Wer finanziert die Studie?
Die Studie wird aus öffentlichen Mitteln und Eigenleistungen der Studienzentren der jeweiligen Einrichtung finanziert. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) befürwortet das Studienkonzept ausdrücklich.
Wer kann mitmachen?
Personen, die zum Zeitpunkt der Rekrutierung zwischen 18 und 69 Jahre alt sind und seit mindestens einem Jahr einer der folgenden Ernährungsweisen folgen:
- vegan: keine tierischen Produkte
- vegetarisch: kein Fleisch und Fisch, aber Milchprodukte und/oder Eier
- pescetarisch: kein Fleisch, aber Fisch, Milchprodukte und Eier
- omnivor: sowohl pflanzliche als auch alle tierischen Produkte (Mischkost)
Wann geht´s los und an wen darf ich mich für eine Teilnahme wenden?
Die Rekrutierung zur Studie startet voraussichtlich 2024. Bei Interesse oder Fragen zur Studienteilnahme richten Sie sich bitte unter Angabe Ihres vollständigen Namens sowie Ihrer Telefonnummer direkt an das Studienzentrum am Max Rubner-Institut:
COPLANT am MRI
Telefon: +49-721-6625-417
E-Mail: coplant-studie@~@mri.bund.de
Hinweise zum Datenschutz
Treten Sie bei Interesse an einer Studienteilnahme unter Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) mit uns in Verbindung, gehen wir davon aus, dass Sie uns damit Ihre freiwillige Einwilligung erteilen, dass Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme bezüglich einer Studienteilnahme erhoben werden.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden datenschutz-rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Sie können jederzeit Ihre Betroffenenrechte wahrnehmen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzinformation zur Rekrutierung.

